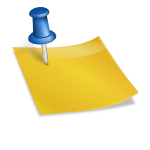Jugendförderung im Fußball: Deutschland und Europas Wege
Der Fußball ist nicht nur ein Spiel der Gegenwart, sondern auch ein Spiegel der Zukunft. Wer heute Talente nicht fördert, steht morgen ohne konkurrenzfähige Nationalmannschaft oder stabile Vereinsstruktur da.
Deutschland, einst ein Musterland der Nachwuchsarbeit, sieht sich derzeit mit der Herausforderung konfrontiert, junge Spieler nicht nur auszubilden, sondern ihnen auch ausreichend Einsatzchancen im Profibereich zu verschaffen. Andere europäische Länder haben hier einen Vorsprung erarbeitet – und zeigen, wie es gehen kann.
Die Situation in Deutschland
Einsatzchancen junger Spieler
Die Bundesliga galt lange als Kaderschmiede für Talente. Doch aktuelle Zahlen zeigen ein anderes Bild: Unter den fünf großen Ligen Europas weist Deutschland die geringste Zahl an Einsatzminuten für U21-Spieler auf. In der Saison 2024/25 waren es nur zwölf unter 21-Jährige, die regelmäßig zum Einsatz kamen. Im Vergleich dazu glänzt die spanische LaLiga mit deutlich mehr Spielzeit für Youngster.
Ein Lichtblick bietet sich allerdings in der 3. Liga. Hier wurde ein Rekordwert bei U23-Einsätzen erzielt: 233 junge Spieler standen in der Saison auf dem Platz, insgesamt kamen sie auf 3826 Einsatzminuten. Dies entspricht einem Anteil von 30 % an den Startelfeinsätzen – eine bemerkenswerte Zahl. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) reagiert auf diesen Trend und erhöht den Nachwuchsfördertopf auf 3 Millionen Euro für die Saison 2025/26. Diese Mittel können von den Vereinen nun auch zur Deckung allgemeiner Kosten eingesetzt werden, was einen zusätzlichen Anreiz zur Förderung junger Spieler bietet.
Strukturen der Förderung
Das Talentförderprogramm des DFB stützt sich auf zwei Säulen: 366 regionale Stützpunkte und 59 Nachwuchsleistungszentren (NLZ), in denen gezielt mit jungen Spielern gearbeitet wird. Diese Einrichtungen sind nach strengen Kriterien zertifiziert, die von Infrastruktur über Ausbildungsqualität bis hin zur Durchlässigkeit in den Profibereich reichen. Hier zeigt sich, dass die Grundlagenarbeit nicht das Problem ist – sondern der Übergang zum Profifußball.
Kritik und Reformbedarf
„Die Technik im deutschen Nachwuchs ist unterentwickelt“, kritisierte zuletzt ein Trainer eines Bundesliga-NLZ. Fehlendes individuelles Training, zu wenig Schulung in Ballannahme, Passspiel und Spielintelligenz seien häufige Mängel. Der Druck auf Profitrainer erschwert zudem den Mut, junge Spieler regelmäßig einzusetzen. Viele Talente verpuffen, weil sie nach der U19 keinen klaren Anschluss finden.
Der DFB steht ebenfalls in der Kritik: Laut einer Untersuchung des ZDF kommen in Deutschland nur 0,95 Profifußballer auf 100.000 Einwohner. In Portugal liegt der Wert bei 5,93 – ein deutlicher Unterschied. Der bekannte Trainer Jürgen Klopp schlug bereits vor, in Deutschland eine U21-Liga nach englischem Vorbild einzuführen. „Wir verlieren viele Talente auf dem letzten Meter. Eine U21-Liga würde Zeit schaffen, um sich zu entwickeln“, so Klopp.
Auch Christian Streich, langjähriger Trainer des SC Freiburg, forderte mehr Mut:
„Es braucht eine klare Haltung im Verein, Talente nicht nur im Training zu loben, sondern auch in Pflichtspielen Verantwortung zu übertragen.“
Ebenso warnt Markus Krösche von Eintracht Frankfurt:
„Es braucht regionale Bindung, Begrenzung der Gehälter im Jugendbereich und deutlich mehr Fokus auf die Ausbildung der Ausbilder.“
Vorbilder und funktionierende Modelle in Europa
Positive Entwicklungen in Deutschland
Einige Vereine gehen bereits neue Wege. Der 1. FC Köln investiert 30 Millionen Euro in ein neues Akademiezentrum, das alle Jugendmannschaften unter einem Dach vereint. Die Talente trainieren gemeinsam mit den Profis auf einem Campus, der kurze Wege und intensive Betreuung ermöglicht.
Auch Borussia Mönchengladbach setzt auf Integration: Der 16-jährige Wael Mohya wurde frühzeitig in das Training der Profis eingebunden – in Absprache mit der Schule. Trainer Gerardo Seoane erklärte dazu:
„Es geht nicht nur um Fußball. Es geht um die ganzheitliche Entwicklung eines jungen Menschen.“
Modelle aus Europa
Andere Länder zeigen, wie erfolgreiche Nachwuchsarbeit aussehen kann. Real Sociedad etwa hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem Talente aus der eigenen Region zu fördern. Spieler wie Mikel Oyarzabal wurden behutsam aufgebaut, teils über Leihgeschäfte weiterentwickelt und dann gezielt in den Profikader integriert.
In Portugal verfolgt Benfica Lissabon eine dezentrale Strategie: Neben dem Hauptzentrum in Lissabon existieren rund ein Dutzend regionale Förderzentren, die auch abgelegene Gebiete abdecken. Damit wird eine deutlich größere Bandbreite an Talenten erreicht – ein Modell, das auch in Deutschland denkbar wäre.
Aktuelle Entwicklungen bei Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt setzt in der Nachwuchsförderung zunehmend auf Kontinuität und sichtbare Entwicklungswege – mit der Wiedereinführung der U21-Mannschaft als zentralem Baustein. Sportvorstand Markus Krösche bezeichnet diesen Schritt zurecht als einen „Gamechanger“: Er ermögliche Talenten wie Elias Baum oder Ignacio Ferri, erste Erfahrungen im Seniorenbereich zu sammeln und dabei Schritt für Schritt in den Profibereich hineinzuwachsen. So steht die U21 selbst für den Übergang – statt direkte, oft zu frühe Sprünge zu erzwingen.
Zudem pflegt das NLZ ein enges Netzwerk zu sieben regionalen Amateurvereinen, die als „Talentmagnete“ fungieren. Ein Nachwuchskoordinator betont: „Wir profitieren enorm von der ehrenamtlichen Arbeit… Über die Vernetzung mit den Partnervereinen haben wir die Möglichkeit, etwas zurückzugeben“ – ein Ansatz, der sowohl Talentförderung als auch Gemeinwohl in den Blick nimmt.
Ein weiterer Eckpfeiler ist die klare Ausbildungslinie vom Grundlagenbereich bis zur U21. Dabei steht laut einem offiziellen Leitbild „die Entwicklung des Talents vor dem Mannschaftserfolg“, begleitet durch personalisiertes Training, festzahlungen in den Trainingsplänen und pädagogische Begleitung im Vereinsinternat. Auch die Verpflichtung von Pirmin Schwegler als „Leiter Profifußball“ unterstreicht Frankfurts Absicht, mentale und organisatorische Strukturen zu stärken: Er soll künftig das Scouting ausbauen und die Verbindung zwischen Jugend- und Profibereich weiter professionalisieren.
Probleme im System: Eine kritische Betrachtung
Reformen beim DFB – etwa die geplante Abschaffung von Tabellen und Meisterschaften in der Altersklasse U6 bis U11 – stoßen auf gemischte Reaktionen. Während einige Experten eine Rückkehr zur Spielfreude begrüßen, warnen andere vor dem Verlust des Leistungsprinzips. Auch die Persönlichkeitsentwicklung von Spielern wird als unzureichend gefördert kritisiert. „Wer im Spiel nie scheitert, lernt auch nicht, mit Druck umzugehen“, sagte ein Jugendtrainer eines Bundesligisten anonym.
Hinzu kommt, dass die Trainerausbildung selbst oft hinterherhinkt. Zu viele Trainer mit mangelnder pädagogischer Ausbildung, zu wenig Austausch zwischen NLZ und Schulfußball, sowie ein Mangel an weiblichen und diversen Vorbildern werden regelmäßig kritisiert.
Wege aus der Krise: Handlungsempfehlungen
Deutschland braucht einen ganzheitlichen Ansatz, der Ausbildung, Struktur und Kultur neu denkt:
- Regionale Förderung: NLZ müssen eng mit Schulen, Vereinen und Kommunen vernetzt werden. Die Fußballförderung darf nicht auf Metropolregionen beschränkt bleiben.
- U21-Liga einführen: Eine eigene Liga für Spieler bis 21 Jahre würde mehr Spielpraxis ermöglichen und die Brücke zum Profibereich schlagen.
- Finanzielle Anreize: Fördergelder sollten an tatsächliche Einsatzzeiten gebunden werden – nicht nur an die Anzahl der ausgebildeten Spieler.
- Ausbildung verbessern: Der Fokus muss auf Technik, Spielverständnis und Entscheidungsfreude liegen – nicht auf frühe Ergebnisse.
- Internationale Inspiration: Die Modelle aus Spanien und Portugal zeigen, wie auch ländliche Regionen erfolgreich eingebunden werden können.
- Trainer fördern: Die Qualität der Ausbildung steht und fällt mit den Trainern. Fortbildungen, Austauschprogramme und pädagogische Schulungen müssen obligatorisch werden.
Förderung am Wendepunkt
Die Förderung junger Fußballspieler in Deutschland steht an einem Wendepunkt. Strukturen sind vorhanden, doch der Übergang in den Profibereich bleibt eine Schwachstelle. Während andere europäische Länder ihren Talenten mehr Spielzeit und Vertrauen schenken, verharrt Deutschland zu oft in alten Denkmustern. Doch die Bereitschaft zur Veränderung ist da – sei es in Form von Investitionen, neuen Förderstrukturen oder inspirierenden Beispielen.
Es liegt nun an Vereinen, Verbänden und der Gesellschaft insgesamt, diesen Weg konsequent zu gehen. Denn der nächste Weltmeister spielt vielleicht gerade auf einem Bolzplatz in Sachsen – oder sitzt auf der Ersatzbank in der Regionalliga. Es ist unsere Aufgabe, ihm den Sprung zu ermöglichen.